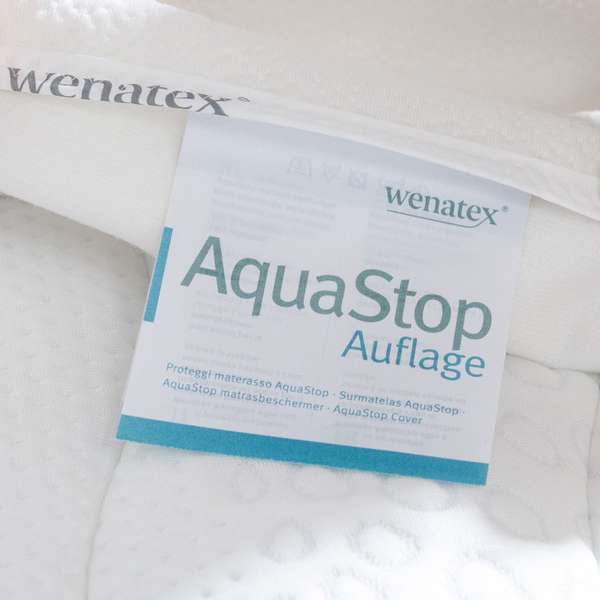Schlafstörungen? Hilfe von Mutter Natur!
Rund 300 bis 400 Millionen Euro, so schätzen die Experten, werden im zentralen Europa pro Jahr allein für schlafanstoßende und schlaffördernde Substanzen ausgegeben, die man ohne Rezept erwerben kann. Dabei ist es oft gar nicht nötig, auf synthetische Pillen zu setzen. Die Natur hat vorgesorgt …
Nicht nur gut fürs Bier: Hopfen
Hopfen und Malz, Gott erhalt’s, sagen die Bierbrauer. Tatsächlich wäre Bier ohne Hopfen eine recht geschmacklose Angelegenheit. Man hat schon vor Jahrhunderten herausgefunden, dass Hopfen auch eine beruhigende und schlaffördernde Wirkung hat.

Hopfen gibt es in Tabletten- und Tropfenform, zusätzlich können Hopfenkissen und Hopfenbäder einen Beitrag zur Verbesserung des Schlafes leisten.
Ein Beispiel für die Zubereitung des Hopfentees: Ein bis zwei Teelöffel Hopfenzapfen werden mit 150 ml heißen Wassers überbrüht, zugedeckt und nach etwa 15 Minuten abgeseiht. Über den Tag verteilt und letztlich auch vor dem Schlafengehen sollten insgesamt zwei bis vier frisch zubereitete Tassen getrunken werden.
Von einer Anwendung während der Schwangerschaft und der Stillzeit sowie bei Kindern unter zwölf Jahren ist allerdings abzuraten, da es in diesen Fällen praktisch keine verlässlichen medizinischen Untersuchungen gibt. Die Frischpflanze kann zudem Allergien auslösen. Mit der Folge Kopfschmerzen, Bindehautentzündung und Blasenbildung der Haut.
Schon bei den Römern beliebt: Melisse
Schlafstörungen sind heute zwar verbreitet wie noch nie, doch schienen auch schon die alten Römer darunter gelitten zu haben. Und dafür hatten sie auch ein Mittel zur Hand: Die Melisse. Medizinisch werden heute noch die Blätter der bis zu 90 cm hohen Pflanze verwendet, deren ätherische Öle hilfreich sind.

Die Blätter enthalten neben den typischen Lamiaceen-Gerbstoffen und Phenolsäuren auch Öle, u. a. Citral und Citronella, die den typischen Geruch erzeugen. In alten Schriften wird die Melisse immer wieder als beruhigend bzw. als Droge bei Krämpfen beschrieben.
In einem Fall scheint bei der Anwendung von Melisse Vorsicht geboten. Dann nämlich, wenn eine Therapie mit Schilddrüsen-Hormonen erfolgt. In Tierversuchen hat man gesehen, dass Melissenextrakte auf die Schilddrüse einen Einfluss haben können. Daher gilt auch hier wieder einmal der gute Rat: Bitte mit dem Arzt besprechen.
Melissentee: Eineinhalb bis viereinhalb Teelöffel (1,5 bis 4,5 Gramm) Melisse werden mit 150 ml siedendem Wasser überbrüht, zugedeckt und nach zehn Minuten abgeseiht. Mehrmals pro Tag eine frisch zubereitete Tasse trinken.
Melissenöl: 0,05 bis 0,2 ml zum Einnehmen oder als Aromatherapie.
Melisse ist im Allgemeinen sehr gut verträglich, eine höhere Dosierung kann jedoch unter Umständen zu einer Beeinträchtigung im Straßenverkehr oder an Maschinen führen.
Von Missionaren nach Europa gebracht: Die Passionsblume
Ihr etwas eigenartiges Aussehen erinnerte europäische Missionare in Südamerika an das Leiden Christi am Kreuz. Sie gaben ihr den Namen: Passionsblume. Der bis zu zehn Meter hohe Strauch wurde bald nach Europa gebracht, wo man seine essbaren Beeren zu schätzen wusste. Aber auch der gesundheitliche Aspekt rückte ins Bewusstsein. Medizinisch wird das getrocknete Kraut jener Triebe verwendet, die Blüten tragen.
Das Kraut enthält Flavonoide, Cumarine, Zucker, Glykoproteine und – in etwas geringerer Menge – ätherische Öle. In alten Rezepturen finden sich die Empfehlungen nach einer kombinierten Anwendung mit anderen Pflanzenstoffen bei nervösen Unruhezuständen und eben Schlafstörungen. Zudem eignet sich die Passionsblume zur unterstützenden Behandlung einer Depression.

Tee: Ein Teelöffel (rund zwei Gramm) getrocknetes und zerkleinertes Passionsblumenkraut mit 150 ml siedendem Wasser übergießen und nach zehn Minuten abseihen. Zwei- bis dreimal täglich und vor dem Schlafengehen eine Tasse frisch zubereiteten Tees genießen.
Viel Erfolg beim Ausprobieren!
Schlagwörter
Weiterlesen

Solange die Sonne scheint, ist alles gut
Wir haben ihn alle im Winter - den akuten Vitamin D Mangel. Und dabei ist es für unseren Stoffwechsel, den Knochenaufbau und zur Stärkung unseres...

Vitamin D Mangel und Schlafstörungen – Gibt es einen Zusammenhang?
Viele Menschen sind von gelegentlichen bis häufigeren Schlafstörungen betroffen. Ursachen gibt es dabei viele. Forscher haben nun einen Zusammenhang zwischen...

Schnarchen – was hilft?
Ein entsetzliches Geräusch – womöglich die ganze Nacht hindurch. Das bringt den Partner zur Verzweiflung: Schnarchen – so laut wie ein LKW oder ein Jet. Was...